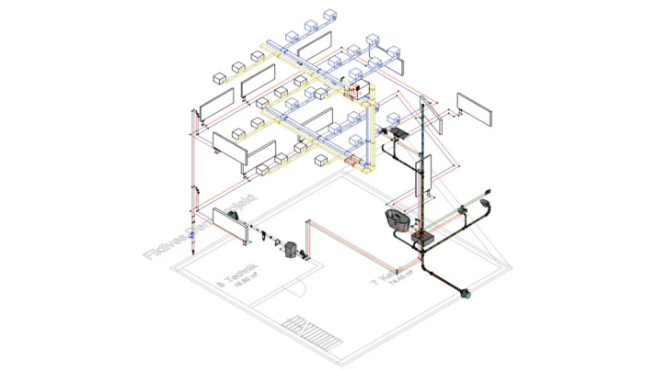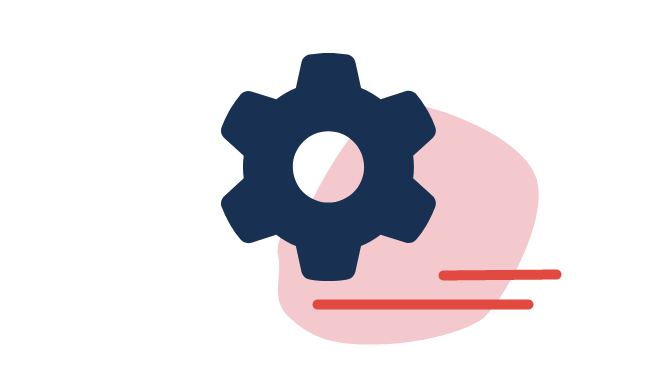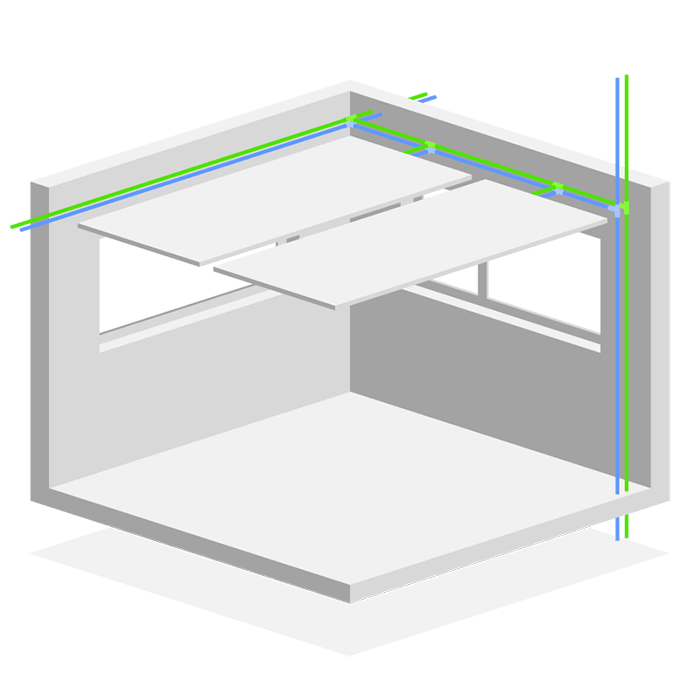
Klima- & Kälteplanung
Die Planungssoftware mh-BIM ermöglicht Ihnen einen durchgängigen Workflow bei der Klima- & Kälteplanung – von der Kühllastberechnung bis hin zur Rohrnetzplanung.
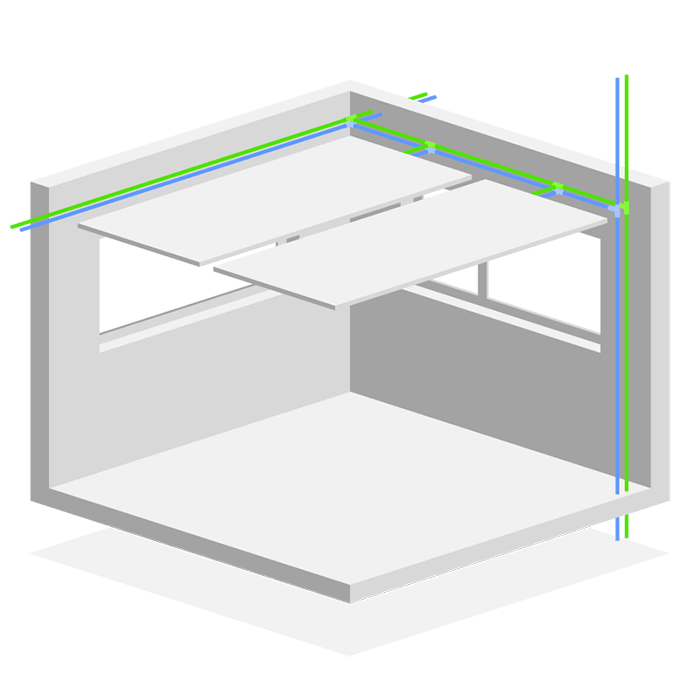
Durchgängige Klima- & Kälteplanung
Vom Grundriss bis zur Abgabe in kürzester Zeit dank des perfekten Zusammenspiels der einzelnen Module. Einen besseren Workflow für Ihre Klima- & Kälteplanung gibt es nicht.
Grafische Gebäudeerfassung
Die Gebäudegeometrie als Grundlage der thermischen Betrachtung.
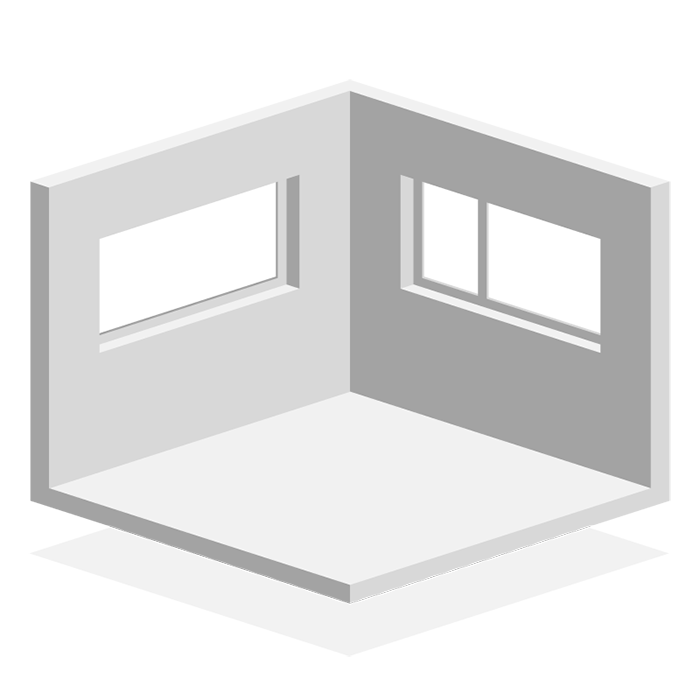
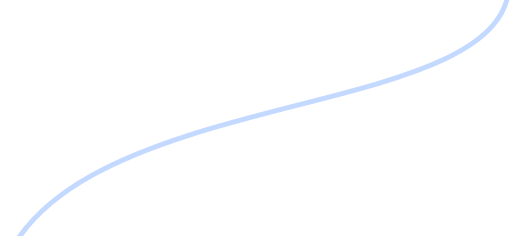
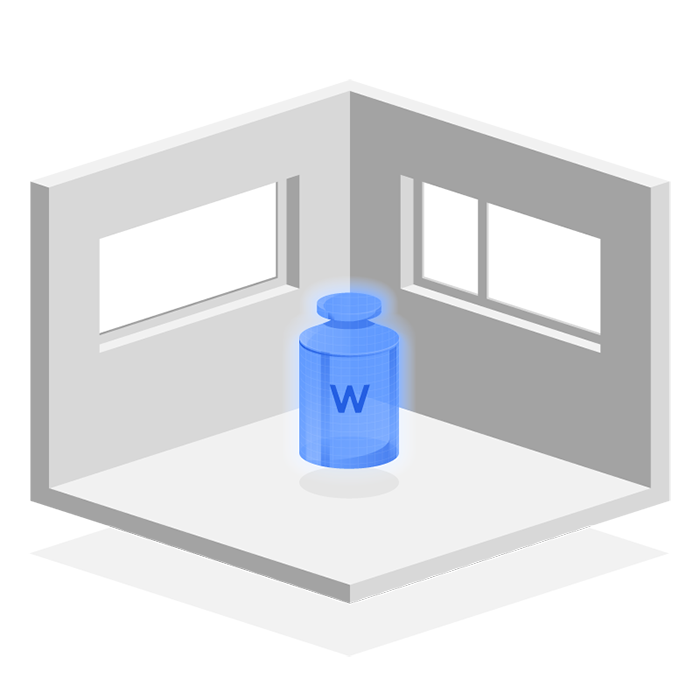
Kühllastberechnung
Kühllastberechnung nach VDI 2078 & VDI 6007 Blatt 1.
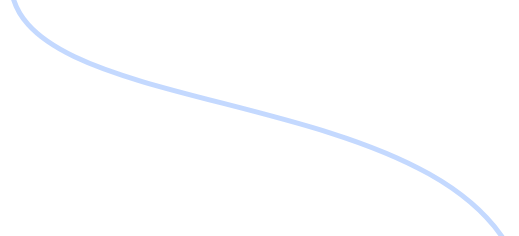
Gebäudeenergiebedarf
Berechnung des Energiebedarfs nach VDI 2067 Blatt 10.
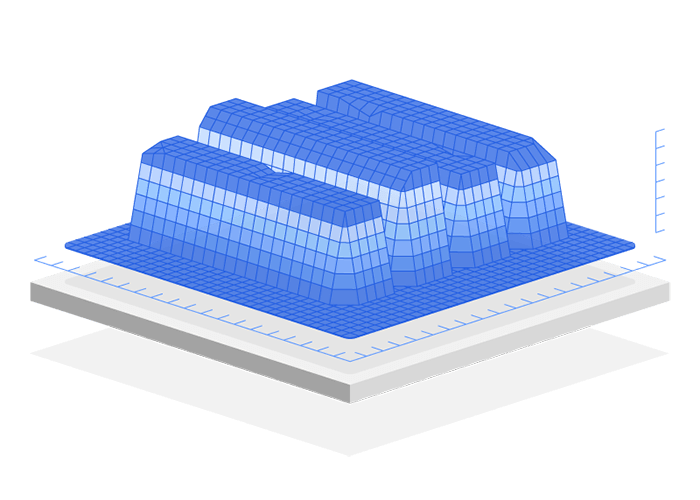
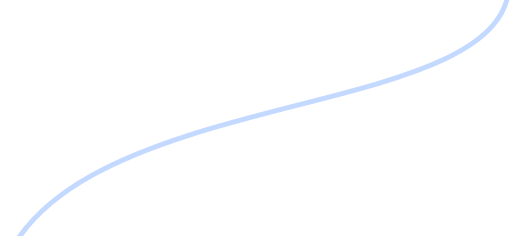
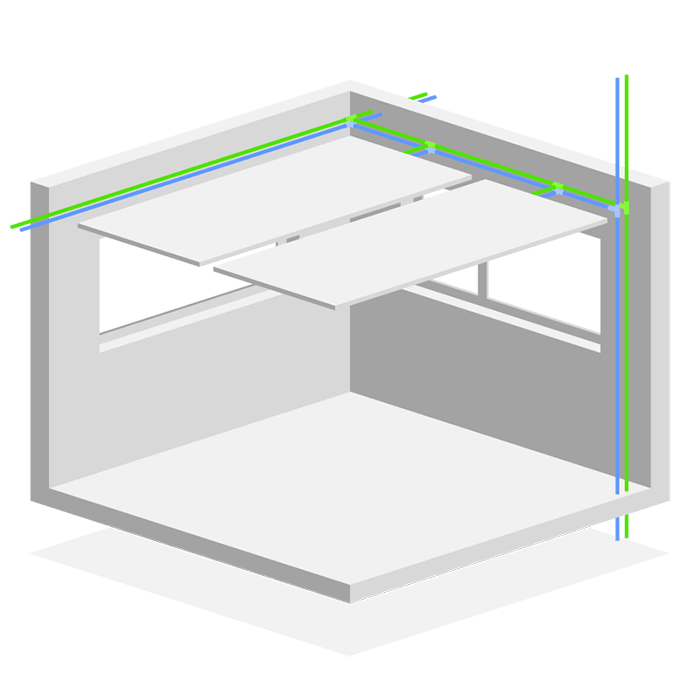
Rohrnetzplanung & Berechnung
Klima- & Kältesysteme konstruieren, koordinieren und in Sekunden berechnen.
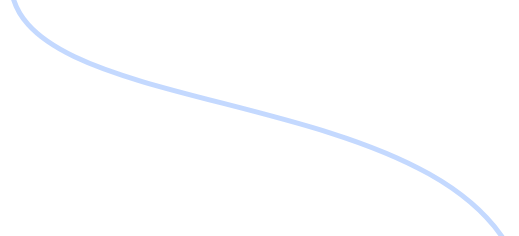
Durchbruchsplanung
Durchbruchsvorschläge einfach erstellen.
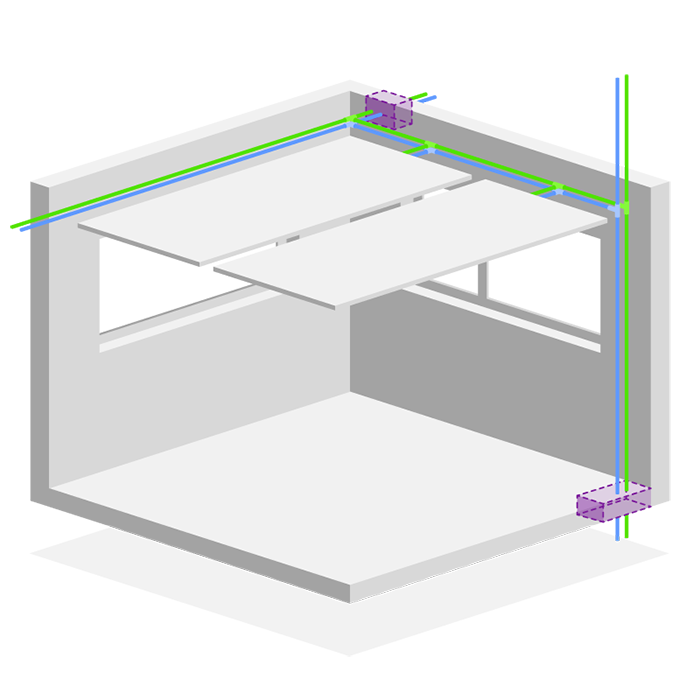
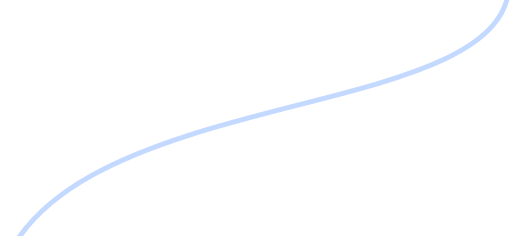
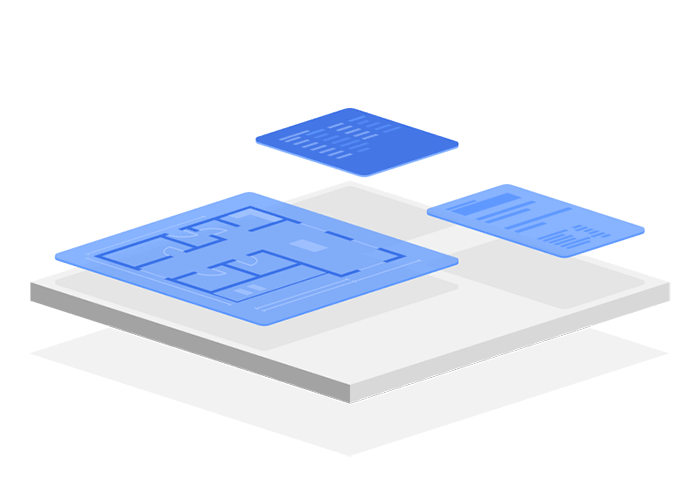
Planerstellung & Abgabe
Höchste Qualität bei Plänen, IFC-Modellen und Massenauszügen.
Durchgängige Klima- & Kälteplanung
Vom Grundriss bis zur Abgabe in kürzester Zeit dank des perfekten Zusammenspiels der einzelnen Module. Einen besseren Workflow für Ihre Klima- & Kälteplanung gibt es nicht.
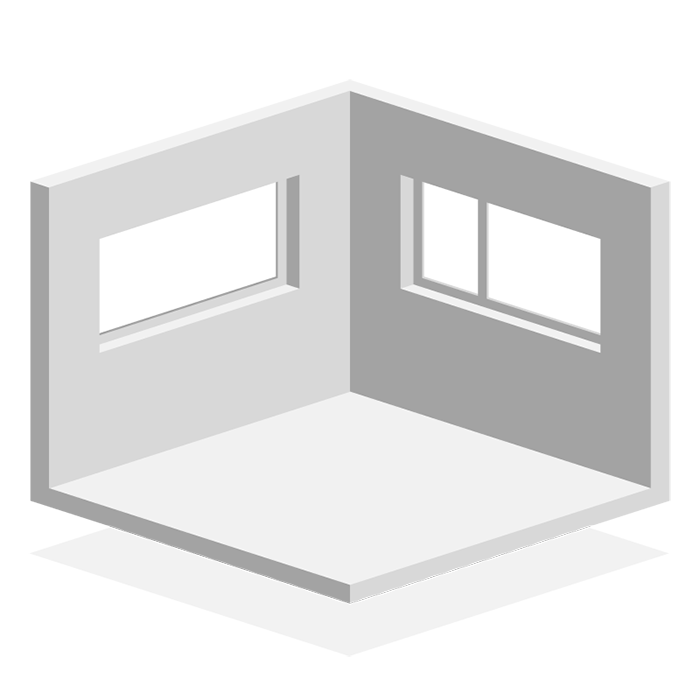
Grafische Gebäudeerfassung
Die Gebäudegeometrie als Grundlage der thermischen Betrachtung.
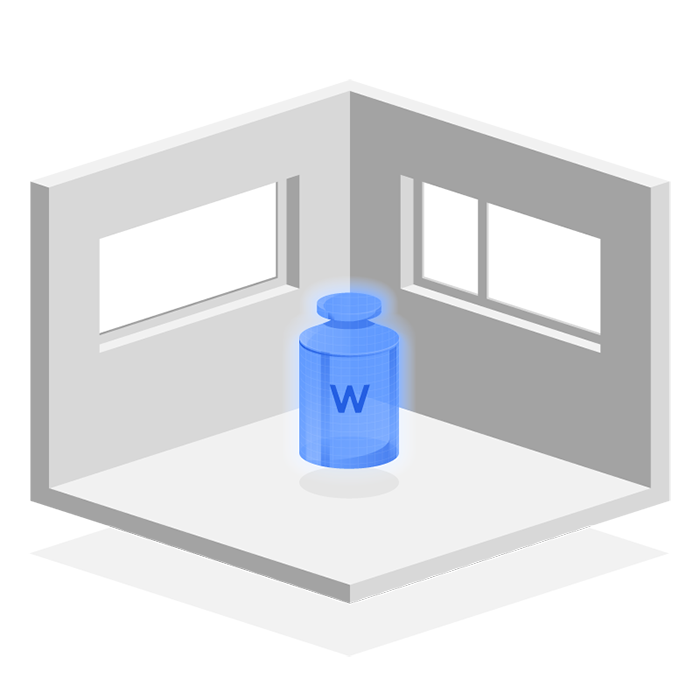
Kühllastberechnung
Kühllastberechnung nach VDI 2078 & VDI 6007 Blatt 1.
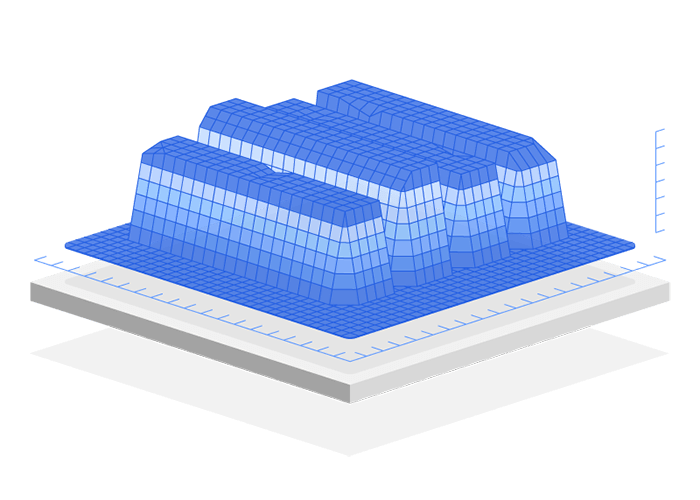
Gebäudeenergiebedarf
Berechnung des Energiebedarfs nach VDI 2067 Blatt 10.
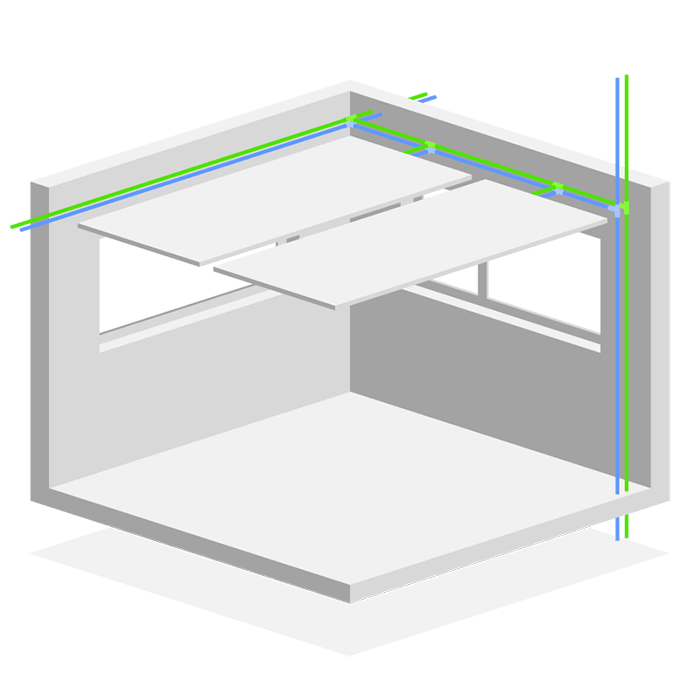
Rohrnetzplanung & Berechnung
Klima- & Kältesysteme konstruieren, koordinieren und in Sekunden berechnen.
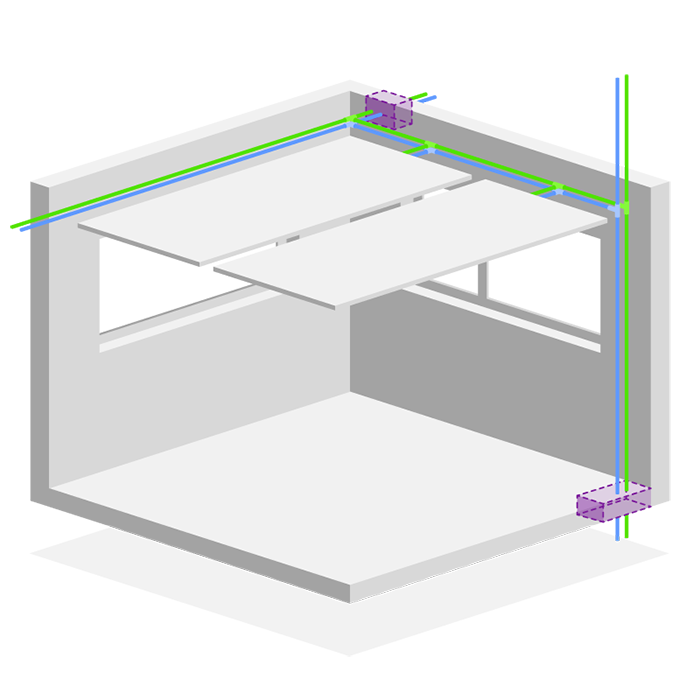
Durchbruchsplanung
Durchbruchsvorschläge einfach erstellen.
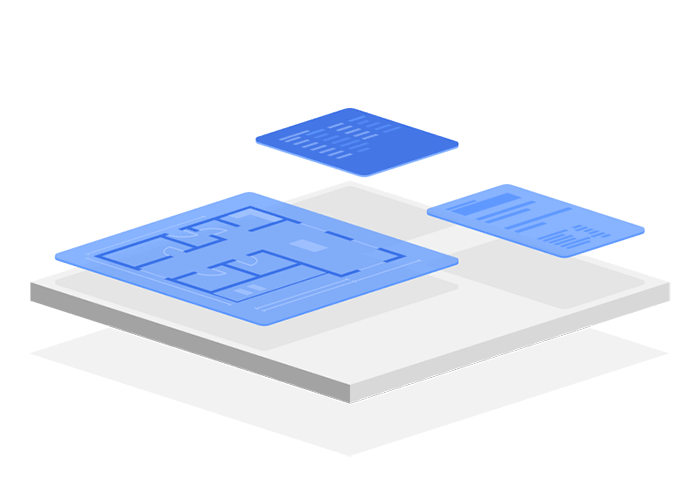
Planerstellung & Abgabe
Höchste Qualität bei Plänen, IFC-Modellen und Massenauszügen.
Das sagen unsere Kunden

„Der Einstieg in mh-BIM fiel mir damals sehr leicht.“
Adrian Sachet
Martin Rehe Consulting GmbH
Inning am Ammersee
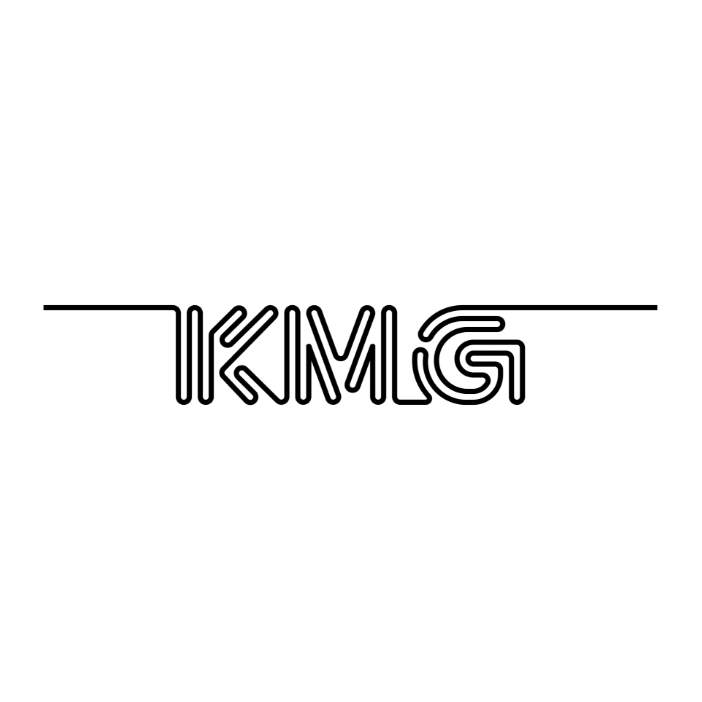
„Mit der Qualität der Berechnungen sind wir sehr zufrieden. mh-BIM liefert uns stets zuverlässige Ergebnisse, wodurch wir auch bei Neuberechnungen sehr viel Zeit sparen.“
Lukas Kirch
KMG Ingenieurgesellschaft für Gebäude- u. Versorgungstechnik mbH
Köln

„Uns überzeugte, dass die Software leicht zu bedienen ist und Korrekturen schnell vorgenommen werden können.“
Martin Ebert
KE & S GbR
Berlin
Das sagen unsere Kunden
Unsere zufriedenen Kunden sprechen für sich.
Bei der Klima- & Kälteplanung perfekt unterstützt
Planen Sie alle Gewerke in einem Modell mit einem durchgängigen Workflow. Egal, ob Heizung, Klima/Kälte, Lüftung oder Sanitär –
mit mh-BIM sind Sie schnell und einfach am Ziel.
Schnell durchstarten
Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und durchgängigen Workflows sind Sie schnell fit und produktiv.
Berechnen & konstruieren in Einem
In unserem 3D-Modell konstruieren Sie exakt & einfach, haben Änderungen schnell durchgeführt und profitieren von der integrierten Berechnung.
Kontrollieren, prüfen & lösen
Überprüfen Sie Ergebnisse visuell im 3D-Model, erkennen Kollisionen frühzeitig und lösen Sie diese komfortabel mit unserer Durchbruchsplanung.
Entspannt abgeben
Immer aktuelle Pläne, Beschriftungen und Daten lassen Sie der Abgabe entspannt entgegen sehen – egal, ob IFC, DWG oder PDF.
Optimale Unterstützung
Falls Sie doch einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser freundlicher Support zuverlässig weiter – darauf können Sie sich verlassen!
Energieeffiziente Gebäude
So erreichen wir gemeinsam unser Ziel: Energieeffiziente Gebäude zu planen, die auch unseren nächsten Generationen eine lebenswerte Zukunft sichert.